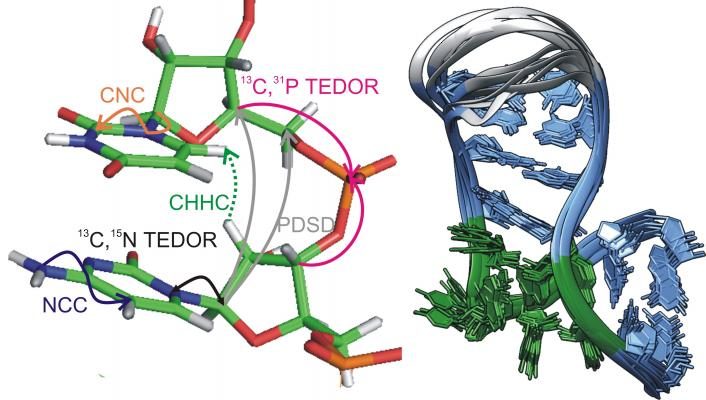
Protein C-Bestimmung zur Einschätzung des Thrombose-Risikos
| Arztgruppen | Allgemeinmedizin, Chirurgie/Gefäßchirurgie, Innere Medizin |
| Bereich | Herz und Blutgefäße |
| Anlass | Vorsorge vor Thrombose |
| Verfahren | Messung von Substanzen im Blut |
| Kosten | Bestimmung der Protein-C-Aktivität zwischen 26 und 30 Euro, Thrombose-Check inkl. weiterer Laborparameter zwischen 120 und 250 Euro |
| GKV-Leistung | Kompressionsstrümpfe und gerinnungshemmende Medikamente in Situationen mit erhöhtem Thromboserisiko (z. B. bei längerer Bettruhe); diverse Untersuchungen bei konkretem Thromboseverdacht; unter Umständen Bestimmung von Protein C bei bestimmten Gerinnungsstörungen |
IGeL
Die Bestimmung der Protein-C-Aktivität ist ein Laborverfahren, mit dem man abschätzen möchte, ob jemand dazu neigt, Blutgerinnsel in Blutgefäßen, sogenannten Thrombosen, zu bilden. Thrombosen sind gefährlich, weil ein losgelöstes Blutgerinnsel eine tödliche Lungenembolie auslösen kann. Protein C ist eine von vielen Substanzen, die für die Blutgerinnung wichtig sind. Wenn man nach den Ursachen bestimmter Gerinnungsstörungen sucht, kann die Protein-C-Aktivitätsbestimmung eine Kassenleistung sein. Bei gesunden Menschen ist die Abklärung einer Thrombose-Neigung immer IGeL. Die Bestimmung der Protein-C-Aktivität kostet in der Regel zwischen 26 und 30 Euro, ein Thrombose-Check, bei dem noch weitere Laborparameter bestimmt werden, zwischen 120 und 250 Euro.
Gesundheitsproblem
Setzt sich in einer tief liegenden Vene eines Beins ein Blutgerinnsel fest, spricht man von einer tiefen Venenthrombose. Oft bleibt sie unbemerkt. Das Bein kann aber auch schmerzen, druckempfindlich sein, sich erwärmen und sich verfärben. Wenn sich das Gerinnsel löst und mit dem Blutstrom über das Herz in ein Lungengefäß gelangt und dieses verstopft, spricht man von einer Lungenembolie, bei der Herz und Lunge versagen können. Man schätzt, dass jährlich 30.000 bis 40.000 Menschen in Deutschland an einer Lungenembolie sterben.
Eine Reihe von Risikofaktoren erhöht die Gefahr einer Thrombose. Man unterscheidet dabei sogenannte Basis-Risikofaktoren und Akut-Risikofaktoren. Als Basis-Risikofaktoren gelten neben der angeborenen Gerinnungsneigung zum Beispiel eigene oder familiäre Thrombosefälle, höheres Alter, eine Schwangerschaft und ein erheblich geschwächtes Herz. Unter Akut-Risikofaktoren versteht man vor allem Ruhezeiten nach Operationen, durch Gipsverbände und längere Bettruhe. Je nach Art und Anzahl der Risikofaktoren kann es sinnvoll sein, durch bestimmte Maßnahmen wie Bewegung, die Einnahme von Medikamenten wie Heparin oder auch dem Tragen von speziellen (Kompressions-)Strümpfen einer Thrombose vorzubeugen.
Eine erhöhte Gerinnungsneigung, auch mit einer Protein-C-Bestimmung, abzuklären, kann dann sinnvoll sein, wenn Thrombosen auftreten, obwohl zunächst keiner der bekannten Risikofaktoren erkennbar ist, oder wenn Blutgerinnsel bei jüngeren Menschen oder an ungewöhnlichen Stellen, wie den Armvenen, auftreten. Dann ist die Protein-C-Bestimmung Kassenleistung.
Methode
Eine Thrombose-Neigung (medizinisch: thrombophiler Hämostasedefekt oder Thrombophilie) liegt vor, wenn Substanzen, die eine Rolle bei der Blutgerinnung spielen, nicht in der richtigen Menge im Blut vorhanden oder nicht richtig aktiv sind. Zu diesen Substanzen gehört Protein C, das die Blutgerinnung hemmt. Das Gen für Protein C ist bei einem von 300 bis 500 Menschen mutiert. Bei ihnen gerinnt das Blut besonders leicht, was das Risiko, eine Thrombose zu bekommen, erhöht. Die Aktivität von Protein C lässt sich im Labor messen. Aus einer erniedrigten Protein-C-Aktivität wird auf ein erhöhtes Thromboserisiko geschlossen.
Empfehlungen anderer
Die S3-Leitlinie „Prophylaxe der venösen Thromboembolie“ von 2009 bezeichnet einen routinemäßigen Thrombophilie-Check für die Allgemeinbevölkerung als nicht sinnvoll.
